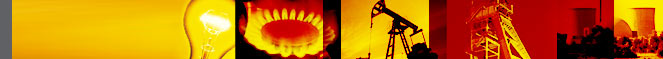Atom

- Atom
Seit dem Atomausstiegsgesetz vom April 2002 sind die Gesamtlaufzeiten der 17 in Deutschland betriebenen AKW auf ca.32 Jahre begrenzt (siehe Anlage 3 zum Atomgesetz).
Restlaufzeit-Übertragungen (von neueren auf alte AKW) sind bisher nicht genehmigt worden (Bundesverwaltungsgericht vom März 2009).
Während in Deutschland bislang lediglich über eine mögliche Verlängerung der Laufzeiten bereits bestehender AKW nachgedacht wird (zum Teil bis LZ 60), laufen in vielen europäischen Ländern die Vorbereitungen für einen Wiedereinstieg in die Atomkraft (Italien, Schweden) oder einen weiteren Ausbau des AKW-Parks (England).
Die Schweiz und Schweden erzeugen ihren Strom nur zur Hälfte aus Wasserkraft, zur anderen Hälfte aus AKW.
Frankreich hat mit 58 Anlagen auf 21 Standorten den höchsten AKW-Anteil in Europa (neben Lettland, das mit dem großen AKW Ignalina ein ehemaliges russisches Prestigeprojekt europatauglich weiterbetreibt). Frankreich drängt mit Macht in den Kraftwerksbau: Der neue EPR wird durch Areva (eine Tochter von EDF) gebaut, Siemens stieg bei Areva aus und arbeitet nun mit den Russen zusammen.
Ein großes Problem ist nach wie vor die Endlagerung, sowie das zu großen Teilen bislang vom Staat übernommene Haftungsrisiko.